Durch Kostensatzdifferenzierung zur besseren Preisfindung.
1. Teil: Die Mängel der Kostensatzermittlung bisher
Die Kostenrechnung der Druckindustrie ist durch die Auftragseinzelfertigung geprägt und setzt als gängige Kostenrechnungsmethode auf die Vollkostenrechnung. Die Vollkostenrechnung rechnet mit kalkulatorischen Kosten, die nötig sind, um zur Wiederbeschaffung von neuen und in der Regel teureren Anlagen beizutragen.
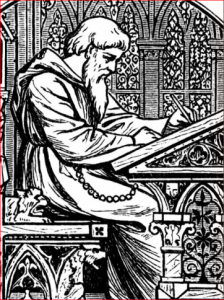 Die bis heute meist übliche Vorgehensweise bei der Berechnung der Stundensätze mittels (Plan-) Betriebsabrechnungsbogen arbeitet mit einer Kostenartengliederung, die im Endeffekt zu einer Verschleierung kalkulatorischer Kosteninhalte führt. Die heute mehr denn je nötige Transparenz der Kostensätze für die Preisfindung wird nicht optimal unterstützt.
Die bis heute meist übliche Vorgehensweise bei der Berechnung der Stundensätze mittels (Plan-) Betriebsabrechnungsbogen arbeitet mit einer Kostenartengliederung, die im Endeffekt zu einer Verschleierung kalkulatorischer Kosteninhalte führt. Die heute mehr denn je nötige Transparenz der Kostensätze für die Preisfindung wird nicht optimal unterstützt.
Konventionell sind die Kapitalkosten „gesamt-kalkulatorisch“ angesetzt (nach Wiederbeschaffungsneuwert und erwarteter Nutzungsdauer). Eine Verbindung zur G+V der Finanzbuchhaltung, die den betrieblichen Erfolg dokumentiert, besteht aber nicht – eine eklatante Vernachlässigung.
Die Abstimmung der angesetzten kalkulatorischen Kosten im Betriebsabrechnungsbogen mit den bilanziellen Werten der Betriebsergebnisrechnung (G+V) muss in aufwändiger Nebenrechnung nachgeholt werden. Denn sie ist notwendig. Die Größenordnung dieser Differenz von kalkulatorischen und bilanziellen Ansätzen eröffnet Spielräume für die Angebotskalkulation, die sich aktiv nutzen lassen. Die Variation des „Gewinnaufschlages“ war bis in die 1980-er Jahre ein ausreichendes Regulativ bei der Preisfindung, genügt aber heute nicht mehr.
Die gängige Aussage des Betriebsabrechnungsbogens führt zu einem weiteren Nachteil: Die Gliederung des Stundensatzes in einen Fertigungskosten-Stundensatz und einen prozentualen Verwaltungsgemeinkosten-Zuschlag verleitet dazu, diesen prozentualen Zuschlag als Manipulationsmasse bei der Preisgestaltung zu verwenden. Wo aber ist der Maßstab, wieviel VV-Kosten notfalls abgeschlagen werden können, um Angebotspreise abzugeben und trotzdem ein bestimmtes Ergebnis- und/oder das Bilanzziel zu erreichen? VV-Kosten beinhalten beschäftigungsfixe und -variable Kosten, Ausgabe- und Nichtausgabekosten, die unterschiedlich auf die Auslastung reagieren.
Weiterhin vernachlässigt der prozentuale VV-Aufschlag bzw. die Umlage der VV-Kosten auf die Fertigungskosten das Prinzip der Kostenverursachung. Die Verteilung der VV-Kosten auf Basis der Fertigungskosten, die alle Kapitalkosten beinhalten, bedeutet, dass kapitalkostenintensive Kostenstellen übermäßig hohe Verwaltungs- und Vertriebs-Kosten zugewiesen bekommen, ohne Verursacher dafür zu sein. Das Argument der Tragfähigkeit schwächt genau diese Kostenstellen bzw. die Investition in diese.
Verbesserte Ansätze zur verursachungsgerechten VV-Kostenverteilung mittels Kostentreibern in der Prozesskostenrechnung (s. Dr. Guido Leidig u. a., Handbuch Prozesskostenrechnung Druckindustrie, Bundesverband Druck) haben sich nicht durchgesetzt bzw. haben sich als nicht praktikabel erwiesen.
Die im 2. Teil vorgestellte Ausgabekostenrechnung umgeht durch eine neue Zeilenstruktur im Betriebsabrechnungsbogen alle oben genannten Mängel. Durch den neuen Zeilenaufbau werden im Stundensatz die Ausgabekosten (Ausgabegrad %), die bilanzielle Aufwendungen (Bilanzgrad %) und der kalkulatorische Überhang transparent.
Autor: Alexander Richter (www.datamedia.org)
